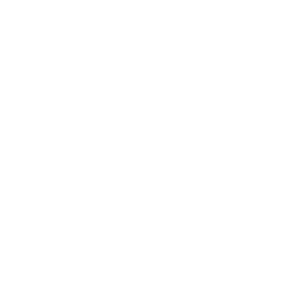„Wir arbeiten daran, das Gehirn zu verstehen“
Am Max-Planck-Institut (MPI) für Neurobiologie in Martinsried werden Gehirn und Nervensystem untersucht: wie sie aufgebaut sind, wie und wodurch sie sich verändern und wie sie funktionieren.
Juli 2018

© Max-Planck-Institut für Neurobiologie
Das MPI für Neurobiologie ist eines von derzeit 84 Forschungsinstituten der Max-Planck-Gesellschaft. Es befindet sich seit 1984 in Martinsried und ist seit 1998 ein eigenständiges Institut. Zuvor war es ausgelagerter Teil des MPI für Psychiatrie in München Schwabing. Das MPI für Neurobiologie liegt direkt neben dem MPI für Biochemie, das schon seit 1973 in Martinsried ist und damit gewissermaßen die Keimzelle war für den ganzen Martinsrieder Wissenschaftscampus. Das MPI für Neurobiologie ist kein kleines Institut; es hat etwa 300 Mitarbeiter aus 40 Nationen und einem Jahresbudget von knapp über 18 Millionen Euro. Zurzeit ist es die Heimat von fünf Abteilungen, jeweils von einem Direktor geleitet, vier unabhängigen Forschungsgruppen und einer Max-Planck-Fellow-Gruppe. Prof. Winfried Denk, zurzeit Geschäftsführender Direktor des MPI für Neurobiologie, gab der „IZB im Dialog“ Einblick in seine Tätigkeit am MPI für Neurobiologie.
im Dialog: Herr Prof. Denk, Sie sind seit dem Jahr 2000 Max-Planck Direktor, erst in Heidelberg und seit 2011 am MPI für Neurobiologie. Wenn man Ihre Vita ansieht, findet man da einiges an Auszeichnungen und Ehrungen. Sie haben unter anderem zwei bedeutende internationale Preise in der Neurowissenschaft gewonnen, den Kavli Prize 2012 und den Brain Prize in 2015, beide im Zusammenhang mit Ihren Arbeiten zum Multiphotonenmikroskop. Nach welchen Kriterien wird man Direktor an einem der weltweit führenden Wissenschaftsinstitute?
Prof. Denk: Fritz Harnack – übrigens ein Theologe – war Gründer
und erster Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der Vorgängerorganisation der Max-Planck-Gesellschaft. Nach ihm ist ein Prinzip benannt, das auch heute noch bei der Auswahl eines Direktors oder einer Direktorin eine große Rolle spielt. Danach ist es wichtiger, nach guten Köpfen Ausschau zu halten, anstatt sich schon von vorneherein auf ein enges Gebiet festzulegen. Wenn man nun jemanden gefunden und berufen hat, muss man nur noch sicherstellen, dass sie/er, ohne sich zu sehr über die verfügbaren Mittel Sorgen machen zu müssen, bis an die Grenzen ihrer/seiner eigenen Vorstellungskraft forschen kann.
Es ist nicht so wichtig, dass man ein riesiges Budget hat, sondern dass man, wenn man eine Idee hat, auch gleich anfangen kann, daran zu arbeiten und gleichzeitig die Sicherheit hat, dass man eine unkonventionellere Idee lange genug verfolgen kann und nicht durch die anfängliche Skepsis der begutachtenden Kollegen gebremst wird. Statt über Geld denkt man über die Wissenschaft nach. Ein paradiesischer Zustand.
im Dialog: Und dabei schaut einem keiner auf die Finger?
Prof. Denk: Doch, natürlich. Mindestens alle drei Jahre wird das Institut durch einen Fachbeirat streng begutachtet. Der Fachbeirat ist ein internationales Gremium, besetzt mit hochangesehenen Wissenschaftlern. Die lassen sich kein X für ein U vormachen, sind aber weniger an der genauen Zahl von Publikationen pro Jahr interessiert, sondern daran, ob man noch ausreichend wissenschaftliche Vorstellungskraft hat.

© MPI
Prof. Dr. Winfried Denk
Elektronen – Photonen – Neuronen
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, neue und bessere Mikroskopie-Methoden für die biomedizinische Forschung zu entwickeln. Einer unserer Erfolge ist die Mitentwicklung des Multiquantenmikroskops. Mit seiner Hilfe wird die starke Lichtstreuung, die besonders auch im Gehirngewebe auftritt und normalen Lichtmikroskopen Probleme bereitet, deutlich verringert. Ein weiterer Erfolg ist die Entwicklung des Dreidimensionalen-Raster-Elektronenmikroskops. Bei diesem automatisierten Prozess tastet ein Elektronenmikroskop die Oberfläche eines Gewebestücks ab; das gewonnene Bild wird gespeichert. Als nächstes schneidet das Gerät eine ultradünne Gewebescheibe ab und erfasst dann die darunter liegende Gewebeebene. Schnitt für Schnitt werden so alle Strukturen in dem vorliegenden Gewebeblock aufgenommen. Abschließend setzt ein Programm alle Bilder am Computer wieder zu der ursprünglichen dreidimensionalen Struktur zusammen – mit dem Ziel, die Schaltkreise des Gehirns zu entschlüsseln.
im Dialog: Ihr Ziel ist es, den „Schaltplan des Gehirns“ zu entziffern. Was heißt das konkret?
Prof. Denk: Als ich in meiner Jugend die Zeit damit verbrachte, die Radioapparate unserer Nachbarn zu „reparieren“, war in den seltensten Fällen ein Schaltplan verfügbar. Wenn doch einmal einer da war, dann war es ganz einfach zu verstehen, welche Funktion jede Komponente hatte. Damit war dann der Fehler meistens zu lokalisieren und oft auch zu beheben.
Das Gehirn ist immer noch die fantastischste aller Rechenmaschinen und doch letztlich durch physikalische Prinzipien verstehbar. Der Schaltplan spielt – davon bin ich überzeugt – eine ganz zentrale Rolle dabei. Wenn man der Sache auf den Grund geht, besteht jedes Rechnen – dabei benutze ich das Wort sehr breit, im Sinne von Informationsverarbeitung – aus dem gezielten Verteilen und Einsammeln von Informationen. An Sammelpunkten – im Gehirn Synapsen und Zellen, im Computer Transistoren und digitale Logikelemente – wird ein elementares Rechenergebnis erzeugt. Oft ist es erst die Nichtlinearität des Schaltelements, die das möglich macht. Das Auslösen eines Aktionspotentials ist ein Beispiel. Damit da kein Unsinn rauskommt, muss der Informationsfluss genau kanalisiert sein. Und das machen die „Drähte“, die natürlich keine wirklichen Drähte, sondern winzige Röhrchen aus Lipid-Membran sind. Diese Röhrchen sind Zellausläufer, die, je nachdem ob sie mehr für das Einsammeln oder das Verteilen von Information verantwortlich sind, Dendriten oder Axone genannt werden. Diese Membranröhrchen können sehr dünn werden und nur das Elektronenmikroskop liefert Bilder, die scharf genug sind, das Röhrchen, dem man gerade folgt, nicht aus dem Auge zu verlieren, wenn es sich durch ein dichtes Geflecht anderer „Drähte“ schlängelt. Und, anders als im Computer, in dem ja oft die Daten von der Verarbeitungsmaschinerie getrennt gelagert werden, sieht es nach allem danach aus, dass die Gedächtnisinformation in dem Verbindungsmuster zwischen den Zellen liegt. Damit könnte man im Prinzip das Gedächtnis auslesen, indem man die Verbindungen rekonstruiert. Ein faszinierender und doch auch sehr erschreckender Gedanke, finden Sie nicht?
im Dialog: Sciencefiktion. Haben Sie je daran gedacht, ein Buch über diese schrecklich faszinierenden Aspekte der Wissenschaft zu schreiben? Einen Roman vielleicht?
Prof. Denk: Dieser Versuchung werde ich widerstehen. Im Grunde meines Herzens bin ich ein Bastler geblieben, der sich am wohlsten im Labor zwischen Messgeräten und halbfertigen Versuchsaufbauten fühlt. Ich habe mich im Grunde immer auf die Weiterentwicklung von Messmethoden konzentriert, bin damit wohl Physiker geblieben.
- Am Klopferspitz 18
- 82152 Martinsried
- Tel.: +49 (0)89/8578-2424